
Geld
|
|

|

|
Geld |
|
Rolf Todesco: Geld. CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 1 (4. August 2016, Amazon), ISBN-10: 1535554452
"Geld" ist ein Buch, das weniger von Geld handelt als davon, was wie als Geld gesehen wird. Es reflektiert mithin eine Beobachtung 2. Ordnung, in welcher eine eigentliche Aufhebung des Geldes im Zentrum steht.
|
|
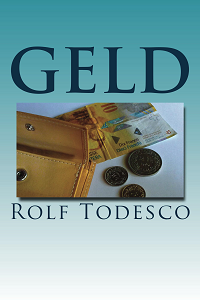
|
1 Geld beobachtenDialog Ich bin an Geld interessiert, hier aber nicht daran, welches zu bekommen, sondern daran, was ich - durch welche Deutung - überhaupt als Geld wahrnehme. Mich interessiert hier nicht, wer wie viel Geld woher hat und auch nicht, wie Geld gerechterweise verteilt sein sollte, ich verfolge hier weder soziale noch wirtschaftliche Fragen. Mich interessiert, worüber ich spreche, wenn ich Geld sage. Ich will mir dia logos, also durch eine Reflexion meines Sprechens bewusst machen, was ich wie als Geld begreife. Im Dialog beobachte ich, was wie gesagt wird und was ich davon unter welchen Voraussetzungen auch sagen kann. Die Worte, die ich verwende, sind nicht von mir. Ich finde sie in meiner Sprachgemeinschaft, also im Sprechen mit andern. Ich wähle Worte, die mir passen und ich erkenne durch meine Worte, wie ich mir Geld vorstelle oder wie ich meine Vorstellungen zur Sprache bringe, wodurch sie erst zu Vorstellungen werden. Im Dialog über Geld können alle Beteiligten auch untersuchen, wie sie selbst über Geld sprechen, also untersuchen, inwiefern welche Redeweisen für sie selbst passen. Im Dialog achte ich auf die Worte. Keine Wirklichkeit zwingt mich, bestimmte Worte zu wählen. Mit der Wahl meiner Worte zeige ich - vor allem mir selbst - welche Form(ulierung) ich für adäquat halte. Vor jeder Reflexion sage ich beispielsweise, dass die Münzen und Noten, die ich im Portemonnaie habe, Geld sind. Damit sage ich zwar mehr über die Münzen und Noten als darüber, was Geld ist, aber gleichwohl kommt in dieser Aussage Geld vor. Solche Aussagen kann ich in dem Sinne beobachten, als ich nach Perspektiven und Handlungszusammenhängen fragen kann, unter welchen solche Aussagen mir sinnvoll scheinen. Als Beobachten bezeichne ich in diesem Kontext das zur-Sprache-Bringen von Unterscheidungen, die ich in meinem Sprechen benenne oder impliziere. Das, was ich zur Sprache bringen kann, bezeichne ich als latentes Wissen. Wissen in diesem Sinne ist dann, was bereits „zur Sprache gebracht“ ist, und zwar unabhängig davon, in welcher Weise es richtig ist. Zur Sprache bringe ich hier, wie ich über Geld spreche, und damit auch, was ich als Geld beobachte. Es geht mir darum, eine Geldtheorie zu entwickeln, wobei ich den Ausdruck „Theorie“ dabei quasi-etymologisch als Erläuterung einer Anschauung verstehe. Durch meine Theorie lege ich nicht fest, was Geld „ist“, sondern mittels welcher begrifflichen Kategorien, also durch welche Sichtweise mir Geld als Geld erscheint. In so verstandener Theorie sehe ich den Sinn eines Dialoges über Geld, in welchem Sichtweisen bewusst gemacht werden. Dialoge unterscheide ich von Diskussionen dadurch, dass es im Dialog um eine Vielfalt von Sichtweisen geht, während in einer Diskussion möglichst eine einzige Sichtweise herbeiargumentiert wird. Ich entfalte hier eine Sichtweise auf Geld, aber keineswegs die Vorstellung, dass jemand Geld auch so sehen müsste. Ich suche im Dialog Nachahmung in Bezug auf das Entfalten von Sichtweisen, nicht in Bezug auf eine bestimmte Sichtweise. Geld habe ich in meinem noch nicht reflektierten Vorverständnis nicht nur im Portemonnaie, sondern etwas weniger anschaulich auch auf „meiner“ Bank und sozusagen in „elektronischer“ Form in oder auf meiner Debit-Geld-Karte. Mich interessiert jede Form von Geld und inwiefern diese Geldformen - insbesondere auch das sogenannte Giralgeld der Banken - für mich Formen von Geld sind. Als Entwicklung des Geldes könnte man einen Prozess sehen, in welchem sich Geld wie etwa ein Lebewesen in seiner Ontogenese entwickelt. Mir geht es dagegen darum, eine bestimmte Sichtweise auf Geld zu entwickeln, in welcher ich Geld als Gegenstand einer Theorie entwickle. Es geht mir dabei um die Entwicklung von Geldvorstellungen, die - dia logos - zur Sprache gebracht sind. Ich kann mir Geld ganz einfach vorstellen, beispielsweise als Goldmünzen, die im Tausch ihren eigenen Wert repräsentieren. Und natürlich kann ich mir auch gesellschaftliche Verhältnisse vorstellen, in welchen auf dem Marktplatz tatsächlich mit Goldmünzen Waren gekauft werden. Ich habe dann eine einfache, noch nicht entwickelte Vorstellung von Geld, die zu einfachen, noch nicht entwickelten Geldverhältnissen passt. Solche Münzen in solchen Verhältnissen habe ich noch nie gesehen, sie kommen aber als unentwickelte Projektionen in meiner Entwicklungsgeschichte des Geldes vor. Auch die Münzen, die ich im Portemonnaie habe, erscheinen mir als unentwickelte Form des Geldes, deren Andeutungen auf höher entwickeltes Geld ich nur verstehen kann, weil ich entwickelteres Geld schon kenne. Einer Münze kann ich weder ansehen, dass sie Geld ist, noch wie sich Geld entwickelt oder entwickelt hat. Ich muss vielmehr eine bestimmte Entwicklung des Geldes voraussetzen, also bereits kennen, um Münzen überhaupt als Geld zu erkennen, zumal mir auf einer entwickelteren Stufe Geld gar nicht mehr in Form von Münzen und Noten erscheint. Würde ich nur Geldmünzen kennen, also in der Steinzeit des Geldes leben, könnte ich mir Hypothekarmarktkrisen, die die Weltwirtschaft erschüttern, nicht vorstellen, schon weil ich mir die dazu nötige Menge von Münzen gar nicht vorstellen kann. Erst das Buchgeld der heutigen Banken lässt mich rückblickend auch adäquat verstehen, was Goldmünzen re-präsentieren und welche Potenziale sie als Geld enthalten. Ich bezeichne das kategoriale Zurückblicken, in welchem ich immer schon weiss, was geworden ist, ohne dies je aus früheren Stadien vorhersagen oder begründen zu können, als Evolutionstheorie, also als Entwicklungsgeschichten, in welchen rückblickend Sichtweisen entfaltet werden. Meine „Geldtheorie“ bezieht sich zwar auf Geld, sie repräsentiert aber vor allem ein Muster meines Beobachtens. Indem ich mich bewusst mit Geld befasse, befasse ich mich auch mit meiner Weltanschauung generell. Was ich als Geld bezeichne, ist nicht von „existierendem“ oder „wirklichem“ Geld abhängig, sondern von meinem Beobachten, das ich in meiner Theorie reflektiere. 1.1 Das Geld-SystemIn der ursprünglichen Form einer Münze erscheint mir Geld als materielles Ding. Das Geldsein der Münze zeigt sich mir aber nicht in diesem Ding, sondern in der Verwendung der Münze, also in Operationen, in welchen Münzen eine Rolle spielen, und die ich als Geldhandlungen begreifen kann. Wo Münzen beispielsweise etwa zugunsten des Metalls eingeschmolzen werden oder wo Banknoten zum Anzünden von Zigarren benutzt werden, sehe ich eine Aufhebung von Geld, weil ich das Geldsein an bestimmte Verwendungen von Geld knüpfe, die andere Verhaltensweisen als Zweckentfremdungen erscheinen las-sen. In diesem Sinn bezeichne ich mit Geld auch einen Handlungs- oder Deu-tungszusammenhang, in welchem ich Geld wahrnehme. Münzen sind nicht immer Geld, manchmal sind sie nur geformtes Metall und Banknoten sind unter eigenartigen Verhältnissen eben eher Streichhölzer als Geld. Als Geld verwende ich Münzen typischerweise, indem ich sie gegen beliebige Waren tausche. Als Geld hat die Münze - so sehr sie mir beim Kaufen dient - keinen Gebrauchswert. Ich muss sie also über kurz oder lang gegen etwas Brauchbares tauschen, also weitergeben, egal, wie lange ich sie zuvor sparend in meinem Portemonnaie oder im Bankschliessfach aufbewahren mag. Geld erscheint mir in dieser Perspektive als Material, das von einem Speicherort zum nächsten fliesst, indem Münzen ihren Besitzer wechseln. Jeder weitere Besitzer des Geldes wird dieses über kurz oder lang auch wieder ausgeben. Diesen Geldfluss kann ich dynamisch als Prozess modellieren. Und insoweit ich die materiellen Grundlagen des Geldflusses als System bezeichne, bezeichne ich meine Theorie als Systemtheorie. Systemtheorie Meine Systemtheorie liefert mir eine Art architektonische Anweisung zum Modellbau, durch den ich Geldflüsse darstellen kann. Im noch unentwickelten Modell fliessen Münzen und Noten von einem Portemonnaie zum andern, mit der Entwicklung des Modelles kommen weitere Geldflüsse hinzu. Diese Geldflussperspektive wird auch als Stocks (Lager) and Flows (Flüsse) bezeichnet. Wenn ich so über Geld spreche, sage ich nicht, was Geld ist, aber dass es durch ein System fliesst und zweitweise in Lagern aufgehalten wird. Am Anfang meines Modellierens liegen für mich Geldbe- und -verhältnisse nahe, die ich selbst quasi unmittelbar erlebe, etwa mein Portemonnaie und mein Bankkonto und was dort passiert. Ich beginne meine Geldgeschichte im Prinzip mit Münzen, die ich durch meine Taschen fliessen lasse, aber ich denke dabei immer schon an die Funktion des Geldes, die ich in den Berichten zu Finanzweltkrisen erkenne. Ich beginne also mit einfachen Modellen und mit einfachen Annahmen und trete dabei in dem Sinne hinter meinen aktuellen Erfahrungsbereich zurück, indem ich ein ganz einfaches Geldsystem beschreibe, während ich in einer bereits sehr hoch entwickelten Geldwelt lebe. Ich beschreibe damit nicht die Entwicklung des Geldes, sondern ich entwickle meinen Sprachgebrauch, indem ich mit einfachen Aussagen beginne. Ich schreibe am Anfang über Münzen, nicht weil Münzen am Anfang des Geldes stehen, sondern weil ich anhand von Münzen mein Beschreiben gut anfangen kann. Das System, durch welches das Geld fliesst, könnte ich als Geldwelt bezeichnen. Das System braucht hier aber keinen Namen, es besteht aus den Operationen, die ich als Geldfluss auffasse. Den Fluss des Geldes stelle ich dar, indem ich die Veränderungen in den Geldbehältnissen beobachte, also beschreibe unter welchen Bedingungen Geld von einem Stock zum andern fliesst. Ich entwickle das Geldsystem, indem ich weitere Geldflüsse einführe, die mir in meinem Alltag so begegnen, dass ich über sie sprechen kann. Dass ich beispielsweise mit einer Plastikkarte oder via Internet Waren, Dienstleistungen oder Hypothekarzinsen bezahlen kann, ist für mich so erstaunlich, wie dass irgendjemand ein Stück Papier als Banknote einfach so als Geld akzeptiert. Meine ganze Darstellung beruht durch die gewählte systemtheoretische Sichtweise auf einer sehr materiellen Vorstellung von Geld, die auch darin ihren Ausdruck findet, dass ich Münzen und Noten als Geld bezeichne. Der Materialismus, in welchem hier Geld erscheint, ist aber kein Resultat, das im Geld zu finden wäre, sondern eine Voraussetzung, die ich dadurch mache, dass ich Geld in dieser Perspektive - gegen jede herrschende Ökonomie - als artefaktisch gebunden begreife. Als Artefakt kann Geld beliebige Formen wie Noten und Münzen annehmen, aber nicht jenseits von geformtem Material existieren. In dieser Hinsicht geht es mir nicht um die Idee von Geld, sondern um Geld. Was in Beziehung zu Geld getan oder gedacht wird, wird von Menschen getan oder gedacht. In meinem Geldsystem geht es aber nicht um Menschen, sondern um Prozesse. Deshalb erscheinen keine Menschen, sondern Rollenträger oder Charaktermasken, die mit Geld wie Roboter - völlig unmotiviert, sozusagen programmiert - tun, was sie tun. Anstelle von motivierten Handlungen treten in dieser Theorie Verhaltensweisen, die als Operationen des Systems mehr oder weniger wahrscheinlich realisiert werden, so wie es im Wettersystem ohne Intentionen von Wettermachern regnen könnte, aber nicht regnen muss. Geld fliesst - wie Wasser von einem See zum andern - von einem Stock zum andern. In diesem Geldsystem kommen also keine Menschen vor, aber die von mir verwendeten Formulierungen sind weitgehend ich-Formulierungen. Ich beobachte, wie Geld im System fliesst, so wie ich beobachte, ob es regnet. Ich sage: „Es“ regnet und über das Geld, „es“ fliesst. Die Aussagen sind also von einem Beobachter, sie dokumentieren seine, respektive meine Beobachtung und sagen mithin mehr über die vom Beobachter verwendeten Unterscheidungen aus als über vermeintlich wirkliches Geld. Jeder Lesende kann also - wie ich es tue - einen kontingenten Vorschlag lesen, wie sie oder er selbst über Geld sprechen könnte. Der geneigte Leser wird das "ich" als ich lesen, und damit Kontingenzen in seinem eigenen Beobachten erfinden, statt eine oder gar die Wirklichkeit von Geld entdecken zu wollen. 1.2 Die Entstehung von GeldMan könnte meinen, dass Geld einfach auf die Welt gekommen sei, weil es mittlerweile so praktisch ist, Geld zu haben. Aber solange sich Geld noch nicht etabliert hat, wird kaum jemand freiwillig Geld annehmen. In Geschichten, vorab in solchen, die als Geschichte gelten wollen, wird erzählt, dass Geld vielerorts mit Gewalt durchgesetzt wurde, indem etwa erzwungene Steuern von deren Eintreibern nur in Geldform akzeptiert wurden. Man musste also mindestens einen Teil seiner Waren gegen Geld tauschen, damit man die Steuern, die man zahlen musste, bezahlen konnte. Autopoiese Ich begreife die Entstehung von Geld als autopoietischen Prozess. So gesehen wurde Geld weder geplant noch hergestellt und schon gar nicht von jemandem strategisch durchgesetzt. Im Handlungszusammenhang „Geld“ sind andere Menschen bereit, mit mir Waren gegen relativ wertlose Münzen oder Geldscheine zu tauschen. In diesen Verhältnissen verwende ich Geldmünzen, die als Artefakte natürlich geplant und hergestellt sind, um die Tauschhandlungen nicht jedes Mal mit Gold oder Schuldscheinen in der Balance halten zu müssen. Diese Münzen fungieren als Werte zwischen Gold und Schuldschein, die innerhalb der jeweiligen Tauschgemeinschaft akzeptiert werden. Man kann sich beispielsweise ein kleines Dorf vorstellen, in welchem auf dem Marktplatz Münzen anstelle von Schuldscheinen akzeptiert werden, weil alle einander kennen. Für Fremde haben diese Münzen keinen oder eben nur den Metallwert. Das kann ich heute nachvollziehen, wenn ich mit Münzen aus einem Ferienland heimkomme, die ich hier nicht verwenden kann. Solchen Tauschgemeinschaften weiten sich genau dadurch aus, dass das Anerkennen ihrer Prägungen um sich greift. Dieses Umsichgreifen verstehe ich als autopoietischen Prozess, der aus sich heraus stattfindet, indem die kritische Operation, nämlich das Akzeptieren von Münzen als Zahlung, hinreichend oft von verschiedenen Verkäufern aufeinander folgt, wodurch ein sich ausweitender Umlauf von Münzen entsteht - der im Prinzip weder geplant, noch gesteuert oder kontrolliert werden muss. In der Übergangszeit kann also ein Fremder, der nicht zur Tauschgemeinschaft gehört, das Risiko eingehen, Münzen, die innerhalb einer Tauschgemeinschaft verwendet werden, zu akzeptieren. Wenn ich in der Schweiz mit Euro bezahlen kann, akzeptiert der Verkäufer Münzen, die hier nichts gelten, weil er weiss, dass er diese Münzen später eintauschen kann. Die Geld-Gemeinschaft vergesellschaftet sich, indem sie ihre eigenen Münzen auch von Fremden entgegen nimmt, die dadurch ihr Fremdsein in der Gesellschaft aufgehoben sehen. Mit „Geld-Gemeinschaft“ bezeichne ich eine Differenz zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Die Gemeinschaft hat kein Geld, weil in der Gemeinschaft gerade nicht getauscht wird. Nachdem aber die Gesellschaft Geld einführt, durchdringt dieses Geld auch die Gemeinschaft und löst sie auf. Der Ehevertrag und das Erbrecht reflektieren die Differenz, in welcher die Subjekte als Familie eine gemeinschaftliche Einheit bilden, die durch Vertrag und Gesetz finanziell vergesellschaftet wird. In diesem Sinne ist Geld Ausdruck einer Vergesellschaftung, in welcher Gemeinschaften aufgelöst und durch Tauschverhältnisse zwischen Individuen ersetzt werden. Geld erscheint als entwickeltste Wertform solcher Verhältnisse. Ich bringe Geld zur Sprache, indem ich Verhältnisse modelliere, in welchen Geld Wert in einer bestimmten Form darstellt. 1.2.1 WertformIn der einfachsten Wertform tausche ich zunächst jede Ware gegen jede andere Ware in entsprechenden Proportionen. Auf dem noch unentwickelten Markt hat jeder beliebige Waren, die er gegen beliebige andere Waren tauscht. Jeder tauscht, was er hat und nicht brauchen kann, gegen etwas, was er nicht hat, aber brauchen kann. Auf der nächsten Entwicklungsstufe, also in der entfalteten Wertform tauscht jeder eine einzelne Ware gegen alle andern Waren, wobei die Waren eigens zum Tauschen produziert werden. Jeder hat dann viel von nur einer Ware, er tauscht mit verschiedenen andern, die je viel von einer anderen Ware haben. Der Tischler tauscht Tische gegen Brot, Leinen oder Katzenfutter, die von anderen Warenproduzenten für den Markt hergestellt werden. Auf der nächsten Stufe tauscht jeder in der allgemeinen Wertform alle Waren gegen eine bestimmte einzelne Ware, etwa gegen Gold. Alle tauschen ihre Ware gegen Gold, wodurch Gold gegen alle Waren getauscht werden kann. Gold ist eine beiebige „Geld-Ware“, die als generalisierte Tausch-Ware taugt, weil Gold einerseits relativ gut haltbar, teilbar und transportierbar und andrerseits relativ wertstabil ist. Als allgemeine Wertform gibt es aber in verschiedenen Geschichten auch Pfeffer, Muscheln und Silber anstelle von Gold. Schliesslich wird auf der letzten Modellierungsstufe in der Geld(wert)form die bestimmte einzelne Ware der allgemeinen Wertform, im Beispiel also Gold, durch Geld vertreten. Eigentliches Geld übernimmt als Stellvertreter die Funktionen, die Gold als Geld hat, wobei die Beliebigkeit, in welcher zunächst Gold gewählt wurde, aufgehoben wird, indem Geld aus jedem beliebigen Material hergestellt werden kann - nur nicht ohne Material. Geld macht Gold, das zunächst als Äquivalenzwertform diente, wieder zur gewöhnlichen Ware, indem ich Gold wie jede andere Ware mit Geld kaufen kann. Geld fungiert in dieser Sicht als Stellvertreter, der die Funktion des Äquivalents der allgemeinen Wertform übernimmt. Während Gold noch den Warenwert der eingetauschten Güter hat, weil man für die Bereitstellung von Gold entsprechend viel arbeiten muss, hat Geld keinen entsprechenden Warenwert mehr, weil die Herstellung einer Banknote nicht sehr viel Arbeit erfordert. Wenn Gold etwa in Form einer Goldmünze als Geld verwendet wird, bezieht es seinen Geldwert nicht mehr aus seinem Goldsein. Eine Banknote, also ein relativ wertloses Stück Papier, hat als Geld den gleichen Geldwert wie irgendein entsprechend geprägtes Stück Gold. Eine Banknote ist in diesem operativ-begrifflichen Sinn kein Schuldschein, kein Beleg und kein Symbol für Geld, sondern Geld. Ich kann die Banknote gegen einen Schuldschein tauschen, oder ich kann mir mittels eines Beleges bestätigen lassen, dass ich eine Banknote auf die Bank gebracht habe. Die Banknote verweist nicht auf einen bestimmten Wert, sie repräsentiert diesen Wert. Das wird auch in Zeiten extremer Inflation nicht anders. Der Wert jeder Ware verändert sich im Laufe der Zeit, weil der ökonomische Wert aktuell und nicht historisch ist. Sichtbar wurde das beispielsweise als die Textilien, die von Handwebern hergestellt wurden, durch den Einsatz von Webstühlen quasi über Nacht viel weniger Wert hatten als zuvor, obwohl sich weder die Qualität der Textilien änderte, noch der Aufwand, der für deren Herstellung nötig war. Die Handweber reagierten mit Maschinenstürmereien. Sie zerstörten Maschinen, weil sie nicht erkannten, dass Wert ein soziales Verhältnis darstellt. Wenn sie Eigentümer der gleichen Maschinen gewesen wären, hätte sie der Wertezerfall nicht betroffen. Sie litten also nicht unter den Webstühlen, sondern darunter, dass sie keine besassen. Ob eine Geldnote für einen Wert steht oder einen Wert hat, kann als Ansichtssache, als Ökonomie gesehen werden, so wie sich Theologen darüber wichtigmachen, ob jenes Brot sein Fleisch ist oder nur bedeutet. Hier geht es mir aber nicht um diese Ansicht, also nicht um die Sicht auf eine Geldnote, sondern um eine Praxis, in welcher ich Noten gegen Schuldscheine tauschen kann. Die begriffliche Bestimmung, wonach die Note Wert hat und nicht nur wie ein Schuldschein auf Wert verweist, ist eine praktische Bestimmung, die in einem dialektischen Sinn jederzeit hinfällig werden kann, wenn sich die Praxis verändert. Ich bin in meiner Geldpraxis gerade dabei, auf Bargeld in Form von Münzen und Noten zunehmend mehr zu verzichten. So kann ich bei mir beobachten, dass ich Geld nicht von Noten und Münzen abhängig mache. Ich verwende andere Unterscheidungen, obwohl ich Noten und Münzen weiterhin als Geld verwende und dann als solches bezeichne. Münzen sind auf dem Markt unabhängig von Geld schon sinnvoll, weil sie als Metallmenge einen Warenwert repräsentieren. Den ursprünglichen Zweck des Prägens von Münzen erkenne ich darin, dass die verwendete Goldmenge in einer Münze so formatiert ist, dass man einerseits sofort und ohne wägen sieht, um welche Menge Gold es geht, und andrerseits auch, ob jemand nicht einen Teil des Goldes abgetrennt und abgezweigt hat, was ich bei Münzen sofort sehen könnte. Goldmünzen tragen zunächst als Inschrift ihr Gewicht, nicht ihren Wert. Ich kann auch heute noch jederzeit sogenannte Anlagenmünzen kaufen, bei welchen ich eine bestimmte Menge des Metalls bekomme und dem entsprechend werden kleine Goldbarren wie Münzen geprägt. Die Autopoiese des gesellschaftlichen Geldes nimmt vorhandene Münzen als Kristallisationskeime, so wie die Autopoiese des Lebewesens auf den Elementen der millerschen Ursuppe aufbaut. Münzen - und noch mehr würde das für Noten, also für Papiergeld gelten - sind in dieser Modellierung nur einführbar, wo sie als Waren personalisierte und kurzfristige Schuldscheine ersetzen. Erst wo sich Münzen lokal bewähren, können sie eine Art Eigenleben entfalten und ihre Funktionalität ausweiten und sich damit als Geld ausdifferenzieren. Die geplante Herstellung und der Gebrauch von Münzen ist in dieser Sichtweise ein Prozess, der in einem überschaubaren Handelszusammenhang beginnt. Münzen wurden in diesem Sinne nicht für die Massen einer Nation erfunden, sondern vergleichbar mit Siegeln, deren Form sie teilen, für Münz-Gemeinschaften, in welchen Münzen den Wert repräsentierten, den sie auf ungeklärte Weise, also fiktiv hatten. Logisch - nicht historisch - viel später wurden die Münzen Geld, weil sie Werte repräsentierten, die konstitutiv begründet waren. Als der US-Präsident R. Nixon 1973 den Goldstandard, also die Verpflichtung der USA ihr Geld mit Gold zu decken, formell aufgehoben hat, waren der Dollar und mithin die Banknoten schon längstens nicht mehr mit Gold gedeckt. Also lange bevor die USA den Schwindel einer Golddeckung aufdeckte, war das Geld durch die Währung der Nation gesichert und keineswegs durch irgendwelches Gold. In meiner Modellierung begreife ich Geld in seiner letzten Entwicklungsstufe als Differenz zwischen Geld und Kredit, und Geld insgesamt wird dabei so unwahrscheinlich wie es Kurantgeld, das seinen eigenen Wert repräsentiert, immer gewesen ist. Auf dieser Stufe erscheint Geld als Ideologie, also als unvermeidliche Illusionen eines notwendig falschen Bewusstseins, dessen Notwendigkeit sich durch die Rationalisierung einer Praxis ergibt. Wenn ich Kredit in jeder Hinsicht wie Geld verwenden kann, muss ich paradoxerweise akzeptieren, dass Kredite Geld sind. Dann aber verwende ich den Ausdruck Geld nicht mehr für Geld, sondern für einen Deutungszusammenhang, in welchem Geld aufgehoben ist. Meine Darstellung lässt sich in diesem Sinne auch als eine Geschichte über die evolutionäre Aufhebung des Geldes lesen, in welcher die Entwicklung des Geldes dazu führt, dass Geld als Giralgeld seine Bedeutung zugunsten des Kredites völlig verliert, aber gerade deshalb möglich macht, dass nun Kredite in Form von Giralgeld als Geld bezeichnet werden. Zu Evolutionsgeschichten gehört, dass rezente Formen des Evolutionären in der Aufhebung nicht verschwinden müssen. In der biologischen Evolution beispielsweise gibt es neben der jüngsten Entwicklung in Form von Menschen allerlei rezente Arten wie Mammuts und Elefanten, die nur zum Teil ausgestorben sind. Als Evolution bezeichne ich ganz besonders die Vorstellung, dass ich Mensch und Tier einander gegenüberstelle, gerade weil sie unter evolutionären Gesichtspunkten dasselbe in verschiedenen Formen sind. Obwohl der Mensch in dieser Differenz kein Tier ist, sage ich beispielsweise, dass er ein werkzeugherstellendes Tier sei. In der Evolution des Geldes gibt es in der vorliegenden Geschichte im Giralgeld aufgehobene rezente Arten wie kurante Goldmünzen und Banknoten, mit welchen ich meine Darstellung des sich in neuen Qualitäten verflüchtigenden Geldes beginne. 2 Kurant-GeldIch beginne meine Darstellung mit Kurantgeld, also mit Geld, das seinen Wert als Ware repräsentiert, indem etwa auf einer Goldmünze durch Prägung steht, wieviel Gold sie wert ist. Eine kurante 20-Franken-Goldmünze würde also - wenn es sie gäbe - Gold im Wert von 20 Franken enthalten. Kurantgeld ist die naivste und einfachste Vorstellung zu Geld, das dann eben deshalb wertvoll ist, weil es aus Gold oder Silber besteht. Ich beginne meine Modellierung mit kuranten Münzen, weil es mir zunächst nicht um den spezifischen Wert des Geldes, sondern um den materiellen Geld-Fluss geht. Kurantgeld erscheint mir als doppelt sinnvolle Fiktion. Zum einen hilft die Fiktion, Geld praktisch einzuführen, weil niemand viel riskiert, wenn er kurantes Geld in Zahlung nimmt. Und zum andern dient die Fiktion hier beim Modellieren, weil sie den Geldwert neutralisiert, so dass ich den Geldfluss ohne Wertüberlegungen beobachten kann. Zunächst fliessen also nur kurante Goldmünzen. Stocks and Flows Mit „Stocks and Flows“ bezeichne ich ein Konzept, das zu einer bestimmten Auffassung einer Systemdynamik gehört. Als Eigenname steht „System Dynamics“ für eine Methodologie, die beschreibt, wie das Verhalten von kybernetischen Regelkreisen auf Computern quantitativ simuliert werden kann. Diese Dynamik sehe ich in Flüssen (Flows), deren Wasser in Stauseen zwischengespeichert werden, oder technischer gesprochen in Speichern (Stocks) kondensieren, bevor sie weiter fliessen. Ein technisches Beispiel für einen solchen Stausee ist der WC-Spülkasten, der nach jeder Leerung automatisch wieder gefüllt, aber nicht überfüllt wird. Das Füllen braucht Wasser und Zeit und das Nichtüberfüllen braucht einen Steuerungsmechanismus, der den Zufluss bei Bedarf in Gang setzt und rechtzeitig wieder unterbricht. Hier beobachte ich Geldbehälter wie etwa mein Portemonnaie, die mit Geld gefüllt, geleert und wieder gefüllt, aber nie überfüllt werden. Mit „Stock“ und „Flow“ bezeichne ich entsprechende Variablen, die dafür stehen, wie viel Geld von wo wohin fliesst und wie viel Geld jeweils wo vorhanden ist. In Geldbehältnissen wird Geld aufbewahrt. Wo im Commonsense zwischen Geld und Wert nicht unterschieden wird, wird dem Geld oft eine Wertaufbewahrungsfunktion zugesprochen. Geld repräsentiert aber immer Wert, also unabhängig davon, ob es in einem Behältnis aufbewahrt oder gerade weitergegeben wird. Die Wertaufbewahrung ist nicht an Geld gebunden. Ich bewahre immer Wert, wenn ich nicht wertvernichtend konsumiere. Wenn ich beispielsweise ein Kilo Gold oder eine Liegenschaft kaufe, bewahre ich den Wert in Form von Gold oder eben der Liegenschaft genauso gut, wenn nicht sogar besser, wie wenn ich Geld aufbewahre. Wert spielt hier aber noch keine Rolle, hier geht es vorderhand nur um kurantes Geld, das zeitweise in den Stocks gestaut wird. 2.1 Mein PortemonnaieMein Portemonnaie sehe ich in diesem Sinne als Stock, das heisst es fliesst Geld rein und raus, aber nie mehr raus, als zuvor rein. Das Portemonnaie repräsentiert hier also einen „Stausee“ in einem Fluss, in welchem Geld in Form einer variierenden Menge von Münzen zwischengespeichert wird. Der Geldfluss verläuft so, dass der Inhalt des Portemonnaies innerhalb eines bestimmten Wertebereiches schwankt. Wenn zu wenig Geld im Portemonnaie ist, wird nachgefüllt, wenn zu viel Geld drin ist, wird rausgenommen. Der Wert der Stock-Variable ist also zu jedem Zeitpunkt eine Anzahl Münzen, die in der Nähe der gewünschten Menge liegt. Ganz ähnlich wie ein Thermostat die Heizung ein- und ausschaltet, wenn es zu kalt oder zu warm ist, fülle oder leere ich mein Portemonnaie, wenn es zu leer oder zu voll ist. Fliessgleichgewicht Schematisch stelle ich einen geregelten Sachverhalt wie die Geldmenge in meinem Portemonnaie durch einen Regelkreis dar. Im schematisierten Regelkreis steht „x“ für den jeweils aktuellen Istzustand und „u“ für die Sollmenge. In Bezug auf mein Portemonnaie besagt „x“ wie viel Geld in einem gegebenen Moment drin ist und „u“ wie viel Geld ich gerne im Portemonnaie hätte. „D“ repräsentiert einen Mechanismus, in welchem „u“ und „x“ verglichen werden. Wenn „x“ grösser oder kleiner ist als „u“ wird in einem weiteren Mechanismus „R“ eine Massnahme ausgelöst, durch die sich „x“ in Richtung „u“ verändert. Wenn sich „x“ verändert hat, beginnt der Prozess von neuem. Ich will beispielsweise immer etwa hundert Franken in meinem Portemonnaie haben. Von Zeit zu Zeit schaue ich nach, wie viel Geld ich habe, das heisst, ich fungiere als Me-chanismus „D“ und vergleiche „u“ und „x“, indem ich die Abweichungen von hundert Franken prüfe. Je nachdem reagiere ich, wobei ich als Mechanismus „R“ die Geldmenge anpasse. Manchmal will ich etwas mehr Geld im Portemonnaie haben, weil ich Einkäufe plane und manchmal etwas weniger, weil ich ins Schwimmbad gehe, wo ich nicht immer auf das Portemonnaie achten kann. Ich verändere also auch den Sollwert „u“, nicht nur den Istwert „x“ – was in diesem einfachen Schema aber nicht dargestellt ist. Die Regelung eines Systems impliziert „Störungen“, ohne Störungen müsste nichts geregelt werden. Der Ausdruck „Störung“ bezieht sich dabei aber auf die Regelung, nicht auf die Funktion des Systems. Das Geld in meinem Portemonnaie trage ich mit mir, um verschiedenste Waren zu kaufen. Darin sehe ich die Funktion des Portemonnaies, das heisst ich will bei Bedarf Geld rausnehmen. Wenn ich Geld ausgebe, „störe“ ich den Sollbestand des Portemonnaies und löse damit eine später folgende Regelungsmassnahme aus. Der Sollbestand meines Portemonnaies würde auch gestört, wenn mir jemand zehntausend Franken ins Portemonnaie legen würde, was mich natürlich gar nicht stören würde, aber eben den Sollbestand des Portemonnaies. Die Pfeile „s“ im Schema stellen einerseits solche Störungen dar, die hier als Mechanismus „S“ etwa mein Kaufen oder Verkaufen von Waren repräsentieren. Intentische Pfeile „s“ repräsentieren aber auch die Regelungsmassnahmen in „R“. Wenn ich Geld ausgebe und so den Sollbestand störe, muss ich wieder Geld ins Portemonnaie legen, um den Sollbestand wieder zu erreichen. Im Modell geht es zunächst nur darum, dass eine bestimmte Menge Geld im Portemonnaie sein sollte und Abweichungen davon durch Massnahmen korrigiert werden. Die Massnahmen sind durch den jewiligen Stock spezifiziert, sie bestehen im Falle des Portemonnaies ausschliesslich im Geldzufluss und -abfluss (Flows). Vorerst ist noch offen, woher das Geld kommt und wohin es fliesst. Und ebenso lasse ich vorerst ausser Acht, dass neben dem Geldfluss oft auch Waren fliessen. Von einem Fliessgleichgewicht spreche ich, weil der Geldfluss so aufrecht erhalten wird, dass im Mittel gleich viel Geld zu- und abfliesst, wobei der Kontostand aber innerhalb eines Bereiches schwankt, also seinerseits „im Fluss“ ist. Feedbacksysteme hinken in dem Sinne immer nach, weil sie auf zuvor eintretende Abweichungen reagieren. Wenn ich Geld ausgebe, habe ich weniger Geld im Portemonnaie bis ich es wieder auffülle. Feedbacksysteme sind praktisch nie im Gleichgewicht, das heisst, „u“ und „x“ sind nie gleich gross, sie fliessen immer zum Gleichgewicht. Wenn ich beispielsweise 18.75 Franken ausgegeben habe, lege ich bei nächster Gelegenheit 20.00 Franken ins Porte-monnaie. Meine Korrektur schiesst dann ein wenig über das Ziel hinaus und verlangt im Prinzip eine weitere Korrektur oder eben etwas Toleranz bis zur nächsten Störung. 2.2 Mein BankkontoMein Bankkonto ist in dieser Modellierung zunächst wie mein Portemonnaie, nur etwas (oder beachtlich) komplizierter: Einerseits geht auch Geld rein und raus, soweit ist es das Gleiche. Dann aber kann ich - erstaunlicherweise oder scheinbar - mehr Geld rausnehmen als ich zuvor reingegeben habe, ich kann das Konto überziehen, was bei einem Lager oder Speicher im Prinzip nicht geht. Deshalb ergänze ich das Bankkonto-Modell mit einer weiteren Zuleitung. Dann kann ich wieder sagen, ich kann nur so viel rausnehmen, wie zuvor reingelegt wurde. Jetzt stellt sich die Frage, woher mein Konto, wenn nicht von mir, sein Geld bezieht, oder woher der zweite Zufluss kommt. Gemeint ist nicht, dass mein Arbeitgeber oder ein Kunde mir Geld auf mein Konto bezahlt. Das ist ja mein Geld, das er an meiner Stelle einbezahlt. Gemeint ist Geld, das nicht mir gehört, also Geld, mit welchem ich das Konto überziehen kann. Ich bezeichne die zweite Leitung als Bankgeld und den Herkunftsort des Geldes als Konto der Bank. Dieses Konto der Bank ist wiederum ein Stock und muss deshalb natürlich selbst eine Geldzuleitung haben und zweitens „bereit sein“, Geld in mein Konto fliessen zu lassen. |
Bestellen als
Buch bei Amazon für Euro 16.-
Kindle (e.book) bei Amazon für Euro 5.-