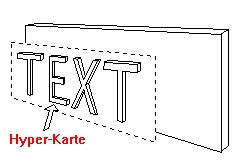
in: Storrer, Angelika / Harriehausen, Bettina: Hypermedia für Lexikon und Grammatik, Narr, Tübingen 1998
Hypertexte mögen praktischen Nutzen haben - was, falls es auch
in diesem Band nicht getan wurde, noch zu zeigen wäre -, ich will
mich mit ihrem theoretischen Nutzen befassen und dabei quasi in
Kauf nehmen, dass praktische Anweisungen zum Schreiben von
Hypertexten anfallen. Indem wir Hypertexte produzieren, wird uns
neu bewusst, was Text überhaupt ist, und wozu wir Text verwenden
(können). Kommunikation mittels Hypertext kann mit dem
traditionellen Sender-Empfänger-Modell nicht adäquat beschrieben
werden. Die Informationsmetapher, also die Vorstellung, dass mit
Text Inhalte übermittelt werden, wird als Beschreibung trivialer
Verhältnisse entlarvt. Hypertext revolutioniert unsere Auffassung
von Kommunikation, indem durch Hypertext die Unterscheidung
zwischen Autor und Leser im hegelschen Sinne aufgehoben, also auf
eine neue Stufe gestellt wird.
Hypertext ist politisch revolutionär, weil er wie die
Enzyklopädie in der Aufklärung und die übersetzte Bibel in der
Reformation dem Anspruch auf Text statt auf Lehrmeinungen und
Interpretationen gerecht wird. Die Enzyklopädie, ein seiner
Struktur nach noch schwach entwickelter Hypertext, ist keine
Erfindung der Aufklärung, aber sie hat die Textform, die wir mit
Aufklärung, also mit dem Kampf gegen Dogmen und mit moderner
Wissenschaft schlechthin assoziieren.
Ich erläutere zunächst genauer, was Hypertext ist, das heisst,
weshalb Hypertext mehr mit Text als mit Computern und Multimedia
zu tun hat. Ich diskutiere dann, welche Form von Lesen mit
Hypertexten korrespondiert, respektive dass Lesen durch Hypertext
auf einer neuen Ebene als subjekt-, statt als textbestimmter Akt
erkennbar wird. Schliesslich frage ich danach, wie Hypertexte
konstruiert sein müssen, damit sie das Lesen, das sie provozieren,
effizient unterstützen.
Hypertext sind - von Multi und Media unberührt - Konglomerate
von auf sich verweisenden Textteilen, die im Wissen konstruiert
werden, dass der Leser selbst entscheidet, was er wann und in
welcher Reihenfolge lesen will. Jedes Telefonbuch besteht aus
Textteilen, die der Leser nach seinem Gutdünken konsultiert. Und
jedes Lexikon hat ein Verweissystem, das dem Leser Hinweise auf
semantische Nachbarschaften gibt, die er lesen kann, wenn und wann
er will. Hypertexte werden auf Hypertextmaschinen, also auf
Computern mit entsprechenden Programmen, hergestellt und gelesen,
weil es solche Maschinen gibt und sie sehr praktisch sind. Aus
demselben Grund verwenden wir Textverarbeitungen für konven-
tionelle Texte, ohne dass die Texte dadurch an inhärenter Qualität
gewinnen. Was mit Computern als Trägern von Hypertexten praktisch
gewonnen wird, ist das effiziente Nachschlagen von bestimmten
Textteilen und das Verfolgen von Verweisen in andere Textteile.
Die Textteile eines Hypertextes heissen Karten (1).
Hyper-Karten sind wie alle Texte Mengen von
grammatikalisch geordneten Zeichen, die zu Wörtern, Sätzen, Abschnitten
usw. zusammengefasst sind, und die innerhalb des Hypertextes
als konstruktiv festgelegte Ziele ausgezeichnet sind, auf
welche der Hyperleser von anderen Karten verwiesen wird. Jeder
Hyperverweis zeigt auf eine Karte.
Die Kartenmetapher wird oft missverstanden. Sie wird von den
Hypertextmaschinenherstellern verwendet, um die Organisation ihrer
Softwareprodukte anhand von Karteibeispielen wie Agenden und
Adressverwaltungen anschaulich zu machen. Probleme, die man früher
mit Karteien löste, löst man auf dem Computer schon lange mit
Schablonen, die Datenbankinhalte benennen. Aber Hypertextkarten
sind weder Schablonen noch Textträger wie Karten oder Buchseiten,
sondern Texteinheiten, die im Unterschied zu Karteikarten kein
Format und keine textexterne Sortierordnung haben. Natürlich kann
man mit den gängigen Hypertextmaschinen auch Karteien simulieren,
aber dann schreibt man keinen Hypertext, sondern eine Karteien-
applikation etwa im Sinne einer Adressverwaltung.
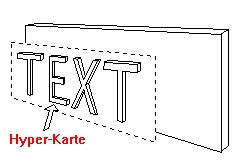
In Hypertexten sind die Verweisadressen auf andere Karten
implizit, das heisst der Leser kann sich die gewünschten Karten
durch Anklicken einer Maschinenfunktion, die mit dem jeweiligen
Verweisausdruck verbunden ist, auf den Bildschirm holen. Diese
Funktionen werden Links genannt. Das entscheidende Konstruktionsmerkmal
für Hypertexte sind aber die Karten, nicht die Links. Die
Links helfen lediglich die Karten effizient zu erreichen. Wer in
einem Hypertext schreibt, muss sich für Karten entscheiden, die
Links sind dann nur noch logische Folgen.
Weil die Hypertextteile durch ”Links” verbunden sind, gilt auch
der CIA-Agent Vannevar Bush, der bereits in den 40er Jahren ein
Archivsystem mit Links auf Mikrofilmen vorgeschlagen hat, als
einer der Erfinder von Hypertext. Und weil Hypertextmaschinen mit
Computermäusen funktionieren, wird modischerweise fast jede
cursorsensitive Bildschirmoberfläche als Hypertext bezeichnet und
dementsprechend der Computer-Maus-Erfinder Douglas Engelbart
naheliegenderweise zu den Vätern des Hypertextes gezählt, da man
mit der Maus eben auch in einem Hypertext Bildschirmfelder
anklicken kann. Engelbart hat in der Tat auch die erste eigentlich
Hypertextmaschine vorgestellt. Die Namensgebung NLS (oN Line System)
zeigt aber deutlich, dass er an der Maschine, nicht am Text
interessiert war. So müsste man natürlich alle, die irgendetwas
Relevantes zum Computer beigetragen haben, auch in die Ahnenreihe
von Hypertext stellen. ”Links” und ”Mäuse” sind Erfindungen, die
auch ganz unabhängig von Hypertext genügend Sinn machen, schliess-
lich dient die Maus ganz generell der Cursorsteuerung, während jeder
hinreichend grosse Computerdialog auf Links zu Datenbanken
beruht. Dann aber gäbe es auf Computern nur Hypertext, was gleichviel
ist wie kein Hypertext (2).
Und wenn wir schon bei den Erfindern sind: Dass Ted Nelson, der
in den 60er Jahren begonnen hatte, ein Literatur-Archivie-
rungssystem auf dem Computer zu entwickeln, den Ausdruck ”Hypertext” prägte,
gehört auch zur Erfindergeschichte, die nicht recht
weiss, zu welcher Idee sie Geschichte ist. Auch Xanadu, das Projekt
von Nelson, beschäftigt sich nicht mit Text, sondern mit
einer ”network storage engine”, einem ”file-server programm for
linked compound documents” (Nelson 1987). Wo Hypertext wirklich
erfunden wurde, ist so unbekannt, wie wo die erste Programmiersprache
vom Himmel gefallen ist. Als die technischen Voraussetzungen vorhanden
waren, war in beiden Fällen auch die Sache und
vor allem ein völlig willkürlicher Name da. Auf die nicht
erstaunliche Tatsache, dass es keine Geschichte über den Anfang
der Programmiersprache gibt, obwohl die Programmiersprache die
wohl wichtigste Komponente der Computer ist, habe ich schon früher
hingewiesen (u.a. Todesco, 1992:67). Vernünftigerweise sollte man
auch keine Erfinder von Hypertext erfinden. Entdeckt, das heisst
wirklich erfunden, wird Hypertext erst allmählich, nämlich als
neue Form der Sprache und als neues Paradigma der
Kognitionstheorie, was ich in den nächsten Kapitel genauer diskutieren will.
Das ”Lesen” bleibt auch im Hypertext ein sequentieller Prozess.
Die jeweils konkrete Textsequenz entsteht aber erst im Akt des
Hyperlesens, in welchem eine vom Hyperleser ausgewählte
dissipative, an den Akt des Lesens gebundene Textstruktur
geschaffen wird. Die Autorenschaft im herkömmlichen Sinne ist also
nur noch in bezug auf Textelemente gegeben. Erst im ”Lesen”
entsteht der Text, den der ”Leser” liest. Der ”Leser” wird quasi
zum Schrift-Um-Steller des Textes, den er aus den Textteilen des
Schriftstellers realisiert, und mithin wird der ”Leser” natürlich
auf einem qualitativ neuen Niveau mitverantwortlich, für das, was
er liest. Der ”Leser” sucht sich im Text die Stellen, die mit seinen
aktuellen Bedürfnissen korrespondieren, er wird dadurch zum
Hyperleserautor oder zum Hypertexter, in welchem die Unterscheidung
zwischen Autor und Leser im hegelschen Sinne aufgehoben
ist. Mithin wird in der Schrift nachgereicht, was der
Schriftsteller Brecht auf das Radio abschieben wollte: die
Wiedereinsetzung des Rezipienten als Produzent (Schmitz 1996:13).
Wenn wir uns heute beim Lesen ohne schlechtes Gewissen dabei
beobachten, dass wir kaum einen längeren Text, geschweige denn ein
ganzes Buch sequentiell durchlesen, dann wissen wir eben durch
Hypertext einsichtig geworden, dass konventionelle Texte keine
leseradäquate, sondern eine lehr(er)-adäquate Form haben. Konventioneller
Text beansprucht durch seine Form die Entscheidung,
was der Leser in welcher Reihenfolgen lesen müsste. Konventioneller Text
eignet sich deshalb, wenn der Autor weiss, was
wirklich ist, und was der Leser davon wissen muss, also fürs
Unterrichten oder genauer für erzieherisches Abrichten und für
triviale Literatur. Nicht ganz zufällig ist die Bibel das Buch der
Bücher.
Die Textelemente eines Hypertextes bestimmen nicht, was der
Leser als nächstes liest. Sie halten im Unterschied zu sequentiell
geschriebenen Texten - wie etwa jenem, den Sie gerade lesen - die
dem Benutzer ”aufgezwungene Sequentialität” (Keil-Slawik 1990:167)
möglichst gering. Im Lexikon liest ein aktiver Leser, jemand, der
eigene Fragen hat und selbst entscheidet, was ihn interessiert.
Und wie in einer Korrespondenz, ist bereits das zweite Textstück,
das gelesen wird, primär vom Leser des ersten Textstückes und
nicht vom Textstück selbst abhängig. Denn wüsste man, wie der
Leser das erste Textstück einer Korrespondenz deutet, gäbe es
nichts zu korrespondieren. Und wüsste man, welche Hyperkarten der
Hyperleser als nächste liest, würde man diese Texte in die
aktuelle Karte und mithin konventionellen Text schreiben.
Radikal: Natürlich ist auch das erste Textstück eines Hy-
pertextes das Resultat einer nicht im Text begründbaren Entscheidung.
Jeder Anfang liegt in der Geschichte des Anfangenden.
Wo ich ein Lexikon aufschlage, bevor ich mich im Verfolgen von
Verweisen darin verliere, hat nichts damit zu tun, was im Lexikon
steht. Wo ich beim Arbeiten mit dem Computer das erste Mal
Hilfetexte, die endlos nach weiteren Hilfetexten verlangen, lese,
hat mit diesen nichts zu tun. Und schliesslich beobachten wir uns
schmöckernd oft genug dabei, einen Roman irgendwo zu öffnen und
ein bisschen anzulesen - etwas, was uns Okopenko (1970) mit seinem
hypertextartigen Lexikon-Roman sogar lange vor dem Hypertextboom
sehr nahelegt. Hypertexte haben auch logisch keinen Anfang und
kein Ende, da von jeder Karte auf andere Karten verwiesen wird.
Die einzelnen Briefe einer Korrespondenz bilden zwar per Da-
tierung sehr wohl eine geordnete Reihe, aber eben nur im Nachhinein.
Wenn sie geschrieben sind, sind sie ein Protokoll eines
Kommunikationsprozesses, in welchem ein Leser des Briefwechsels
beobachten kann, welche von den in der Kommunikation möglichen
Textseqenzen im konkreten Falle realisiert wurde. Für den nachvollziehenden
Leser mag sich innerhalb der Korrespondenz auch eine
inhaltlich zwingende Logik ergeben, aus den einzelnen Briefen ist
aber nie ersichtlich, was in den folgenden Briefen steht. Genau
gleich verhält es sich mit den in einem Hypertext wirklich gelesenen
Texten. Die Textelemente eines Hypertextes bilden
lediglich ein Kontingent wirklicher Texte.
Wenn aber der Leser über den Text entscheidet, verliert der Text
den Charakter Mitteilung oder Mittel einer Mitteilung zu sein. In
diesem Sinne untergräbt Hypertext die hirn(physilogisch)verbrämte
Auffassung der Kognitivisten, Kommunikation diene der Übermittlung
von Information im Sinne von allenfalls interpretationsbedürftigen
Inhalten. Eine Art Kommunikation findet vielmehr im Leser statt:
Es ist seine eigene Energie, mit der er die Irritationen, die der
Text in seinen Sinnen auslöst, kompensieren muss, um sein Selbst
oder die Organisation seiner selbst aufrecht zu erhalten.
Hypertext zwingt uns über die Konstruktion und die Funktion von
Text neu nachzudenken.
Wenn Text nicht mentalistisch abgehoben, eine "(schriftlich fixierte) im Wortlaut festgelegte Folge von Aussagen" (LexiRom 1995), sondern ein von Menschen intentional hergestelltes Produkt ist, kann man nicht nur nach seiner Wirkung, sondern auch nach seiner Gegenstandsbedeutung (Holzkamp 1976:25ff) fragen. Wer Text produziert, mag zwar einen von Menschen interpretierbaren Verweis intendieren, aber er konstruiert einen physischen Gegenstand, also etwa eine Graphitkonstruktion auf Papier, die wir als Artefakt auffassen können, ohne uns dafür zu interessieren, was der Text für wen bedeuten soll. Text heisst dann jede durch eine Grammatik (Chomskygenerator) generierte Menge von Zeichenketten, unabhängig davon, wozu wir sie verwenden. Abstrakt, als Texte sind sich ein Computerprogramm und ein Liebesbrief gleich. Die Gegenstandsbedeutung von Text liegt nicht in deren Verwendung und ist nicht eine irgendwie geartete inhaltliche Bedeutung, die mittels Text übermittelt werden soll, sondern die Bedeutung des gegenständlichen Textes selbst, also seine gegenständliche Funktion im übergeordneten Prozess.
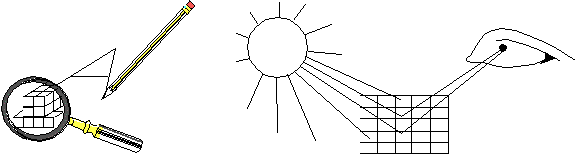
Als Artefakt fungiert Text als Menge von Schaltern, mit welcher wir die Signale, etwa am Graphitpixelmuster gebrochenes Licht, die ins Auge des geneigten Lesers kommen sollen, steuern (Todesco 1995:685ff). Die Grammatik bestimmt durch Produktionsregeln und semantische Bedingungen, welche Pixelmuster als Texte zulässig sind. Die Produktionsregeln von hinreichend grossen Sprachen bewirken, dass wir zwar mit endlich vielen Zeichen unendlich viele Texte erzeugen können, dass aber bestimmte Zeichenketten, bestimmte Wörter und bestimmte Wortgruppen sehr häufig vorkommen. Deshalb kann man jeden Text als Kombination von typischen und von spezifischen Textelementen auffassen. Als Konstruktionselemente von Text erweisen sich dann nicht Buchstaben, Wörter oder Sätze, sondern die Elemente, die zwar aus Zeichen bestehen, die wir aber nicht mehr konstruieren müssen, weil sie wie Buchstaben und Wörter bereits zur Verfügung stehen.
Natürlich sind wir, wenn wir Text erzeugen, nicht an den Re-
aktionen auf der Retina des Lesers interessiert. Was aber beim
Lesen von Texten hinter dem Auge geschieht, ist komplex, von
aussen schlicht nicht rekonstruierbar. Auch die kognitivististe
Hirnphysiologie liefert nicht die geringsten Anzeichen dafür, dass
wir diese Prozesse hinter den Augen des Lesers von aussen je
anders als behavioristisch verstehen könnten: Wir haben das
Gefühl, verstanden zu werden, wenn andere Menschen, nachdem sie
unsere Texte gelesen haben, etwas tun, was mit unseren Erwartungen
in dieser Situation korrespondiert.
Wenn der Leser wie eine triviale Maschine funktioniert, die auf
bestimmte Eingaben mit festgelegten Ausgaben reagiert, bestimmen
wir mit Text natürlich das Verhalten des Lesers. Wenn wir andere
Menschen mit Text steuern, so wie wir Computer mit Programmtext
steuern, reagieren diese Menschen eben behavioristisch abge-
richtet. Nach von Foerster (1993a:144ff) ist Erziehung bis hin zum
Militär der Versuch, den Zögling zu trivialisieren, ihn dahin zu
bringen, dass er auf Texte in vorhersehbarerweise reagiert.
Wo konventionell geschriebene Texte im Nachhinein in ver-
meintliche Hypertexte verwandelt werden, geraten diese fast
zwangsläufig zu modern aufgemachten, im Grunde aber reichlich
überholten (computerunterstützten) Lernprogrammen, in welchen der
Lernende sogar häufig nur weiterlesen darf, wenn er bestimmte Zwischenfragen
richtig, das heisst im Sinne des Lehrenden, beantwor-
ten kann. Dabei wird die Autonomie des Lesers noch mehr
zurückgebunden als durch ein Buch, die Qualität von Hypertext also
in ihr Gegenteil verkehrt. Das Festhalten am unmündigen Leser, der
auf einen wahren Wissensstand gebracht werden muss, äussert sich
im Zusammenhang mit Hypermedia im Problem ”lost in hyperspace”.
”Lost” ist sehr doppelsinnig: Verlieren nämlich die unmündigen
Leser im Text die Orientierung, verliert der Autor die Führung des
Lesers. Und eine selbstgewählte Odyssee des Lernenden ist das
Letzte, was die Autorität Lehrer gebrauchen kann.
Wenn der Leser aber auf Input nicht wie eine triviale Maschine,
sondern wie ein komplexes System reagiert, ist Text in bezug auf
den Leser eine Intervention mit nicht vorhersehbaren Folgen. Ein
komplexes System anzustossen und schauen, was passiert, mag
zeitweise sehr lustig, die generelle Intention von Text wird es
gleichwohl kaum sein. So muss Text wohl den Autor des Textes betreffen,
das heisst, Text wird primär ein Problem des
Textproduzenten lösen. Auch wer Text für andere produziert,
erfüllt zunächst ein eigenes Anliegen. Wer etwas mitteilt, will
etwas mitteilen, auch wenn er es nur mitteilen will, weil er
glaubt, der andere wolle es wissen. Hinter jedem Text steht in
diesem Sinne zuerst, was der Textproduzent mit dem Text verbindet.
Wenn der Text während des Hyperlesens erst entsteht, muss er seine
Bedeutung unabhängig davon, was jemand mitteilen will, im
Hyperleserautor haben.
Wenn wir mit Text zunächst unsere eigenen Probleme lösen, fragen
wir sinnigerweise, was Text für uns ist. Diese Frage muss
logischerweise jeder für sich selbst beantworten. Der Leser dieses
Textes muss mithin entscheiden, ob er im folgenden das Textelement
”ich” als ich oder als er lesen will.
Wenn ich bestimmte Dinge und Zustände in meiner Erfahrung von
Umwelt mit bestimmten Texten in Verbindung setze, Texte also als
Symbole verwende, helfen die Texte mir, mich an diese Dinge und
Zustände zu erinnern, also die damit verbundenen Umweltzustände
innerlich zu wiederholen. Texte haben wie alle Gegenstände, die
ich herstelle oder manipuliere, auch die Funktion eines mate-
riellen, externen Gedächtnisses (Keil-Slawik 1990:147ff). Ein
Hammer etwa erinnert mich unter anderem daran, wie man einen Nagel
einschlägt, das materiellen Textil aus Graphit mit der Form
”Hammer” erinnert mich an einen Hammer, ”Liebe” erinnert mich an
emotionalen Zustände, die ich Liebe nenne.
Dadurch, dass ich auch isolierte Textelemente mit Er-
fahrungselementen verknüpfe, kann ich mit Texten aufgrund von
Kombinationen dieser Textelementen Erfahrungen rekonstruieren, die
ich unabhängig vom Text nicht gemacht habe oder gar nicht machen
kann. Aber natürlich reagiere ich nicht auf isolierte Textelemen-
te, sondern auf Textelemente in Kontexten oder auf Dinge in Konstellationen,
wobei meine Stimmungen selbst zu diesen Konstellationen gehören.
Texte, die mir früher sehr gut gefallen haben,
sagen mir heute eventuell nichts mehr, obwohl sie als Artefakte
dieselben Texte geblieben sind. Und Texte, die mir sehr gut
gefallen, gefallen meinen Mitmenschen bei weitem nicht immer, und
ob ich mich von einem Roman fesseln lasse, hat mehr mit meiner
Muse als mit dem Roman zu tun. Es wäre also auch aufgrund der
eigenen Erfahrung recht naiv zu glauben, dass ein Text an sich als
Beschreibung von etwas oder als Anweisung zu etwas vom Textproduzenten
unabhängig richtig oder falsch sein könnte. Beurteilen
kann ich diesbezüglich nur, ob oder wie gut ich mit einem Text die
mit ihm beabsichtigte Wirkung erreiche. Durch den Text, den ich
jetzt gerade schreibe, wird mir zunächst aussprechbar bewusst, was
Hypertext für mich bedeutet, was mir ohne die materielle
Gedächtnisfunktion von Text in diesem Ausmass nicht möglich wäre.
Und wenn andere Menschen durch meinen Text eigene Texte
produzieren, die sie veranlassen, mit bestimmten meiner Erwar-
tungen zu korrespondieren, dann bedeutet das für mich, dass es
Menschen gibt, die mit Text einen Umgang pflegen, der für mich
Sinn macht.
Texte erinnern mich an das, was sie für mich referenzieren.
Texte können insbesondere auch für andere Texte stehen. Das
Textelement ”Hammer” erinnert mich unter anderem an das
Textelement ”Werkzeug, mit welchem man unter anderem Nägel
einschlagen kann”. Diese Erinnerung ist nicht davon abhängig, dass
man mit einem Hammer wirklich Nägel einschlagen kann, sondern
davon, für welche Textelemente das Textelement ”Hammer” für mich
unter anderem auch steht, also von meinen semantischen Ver-
einbarungen zu ”Hammer”. Wenn ich sage, eine Hexe sei eine Frau,
die zaubern könne, sage ich etwas über meine Textzuordnungen,
nicht etwas über die Wirklichkeit.
Die Verweisstruktur im Hypertext ist offenkundig eine, die
Textelemente verbindet. Hypertexte reflektieren
die operationelle Geschlossenheit unserer Sprache. Dass wir unsere
Aussagen verstehen, zeigen wir unter anderem genau dadurch, dass
wir sie paraphrasieren können, also Textelemente durch andere
Textelemente ”erklären” (Todesco 1996). Hypertext ist also
zunächst eine explizite Vereinbarung darüber, welche Textelemente
innerhalb einer gegebenen Grammatik mit welchen assoziiert werden
können, mithin so etwas wie ein semantisches Lexikon für
Textelemente. Die einfachste Assoziation ist die gegenseitige
Ersetzbarkeit der verbundenen Textelemente. So kann ich etwa in
einem Text die Definition eines Begriffes anstelle des Begriffes
verwenden, ohne dass der Text seine Funktion verändert. Da in der
Definition selbst wieder Begriffe mit Erläuterungsbedarf stehen,
wird die Verweisstruktur zu einem Netzwerk, das, wenn es eine einheitliche
Funktion haben soll, Konsistenz verlangt.
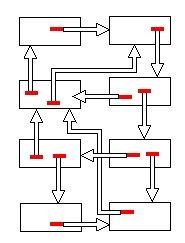
Die Konsistenz von Definitionen in einem Hypertext ist also kein Ziel, sondern eine Konstruktionsbedingung, die bei der Textkonstruktion eingehalten werden muss, damit der Hypertext als Einheit brauchbar ist. Natürlich ist die Konsistenz eines aus einem Hypertext gewählten Textes immer die Konsistenz, die dem Leserautor des Textes gelingt. Die Konsistenz lässt sich aber umso leichter prüfen und intakt halten, je mehr Verweise auf andere Karten die Karten enthalten. Umgekehrt werden Karten natürlich umso übersichtlicher, je mehr Text in andere Karten ausgelagert wird.
Ein Hypertext ist umso entwickelter, je mehr Verweise und je
weniger Redundanz dessen Karten enthalten. Die Entwicklung eines
Hypertextes lässt sich in diesem Sinne als ”formalistisches” Spiel
auffassen, wobei die Konsistenz der Definitionen ein formales
Kriterium bilden. Das Spiel selbst ist zweckfrei wie Schach oder
Mathematik. Man kann es praktizieren wie jeden Weg ohne Ziel. Man
kann das Spiel wie jedes formale Spiel von hinreichender
Komplexität nicht lehren, mitteilen kann man lediglich die
Spielregeln, und wie man vom Schach weiss, ist das in sehr kurzer
Zeit getan (3)
Ziel des Spieles ”Hypertext” ist das Isolieren von Textelementen
höherer Ordnung, die wir Karten nennen. Dass das Resultat des
Spieles, etwa ein Hypertext aus begrifflichen Definitionen, beim
Produzieren von Texten nützlich ist, ist für Hypertext von
gleicher Relevanz, wie für die Mathematik die Tatsache, dass wir
beim Rechnen mathematische Erkenntnisse anwenden können. Letzlich
bleibt unbegreifbar, wieso ein formales Spiel, das durch Regeln
zur Manipulation von Zeichen bestimmt ist, praktische Bedeutung
haben kann (4). Das Unbegreifliche sind nicht unsere Texte, das Unbegreifliche
sind wir. In Anlehnung an den Wiener Psychiater Viktor Frankl, der
von einem seiner Patienten sagte: ”Als er aber erkannte, dass er
blind war, da konnte er sehen!” (von Foerster 1993b:363), gilt für
mich: ”Seit ich weiss, dass man mit Text nichts mitteilen kann,
kann ich Texte verstehen”.
(1) In der
Hypertextsoftware Toolbook heissen die Karten Seiten, was an der
Metaphernlogik nichts ändert, weil die Seiten als gebundene Karten
verstanden werden.
(2) Keil-Slawik (1990:47ff) hat die
Entwicklung der Hypertext-Maschine unter dem Titel ”Meilensteine
der Systemgestaltung” ausführlich beschrieben. Er ist aber auch an
der Maschine, nicht am Text interessiert.
(3) Handelsübliche Hypertextsoftware kann man nach
einer einstündigen Einführung prinzipiell handhaben. Die
irreführende Kartenmetaphorik zeigt hier ihren guten Grund.
(4) Genau diese Frage beschäftigte im sogenannten
Grundlagenstreit der Mathematik eine ganze Generation von
Mathematikern, ohne dass eine plausible Erklärung gefunden wurde.
von Foerster, H. (1993a): KybernEthik. Berlin: Merve Verlag.
von Foerster, H. (1993b): Wissen und Gewissen. Frankfurt/M: Suhrkamp [stw 876].
Holzkamp, K. (1976): Sinnliche Erkenntnis. Historischer Ursprung und gesellschaftliche
Funktion der Wahrnehmung. Kronberg: Athenäum Verlag.
Keil-Slawik, R. (1990): Konstruktives Design: ein ökologischer Ansatz zur Gestaltung
interaktiver Systeme. Berlin: Forschungsbericht
des Fachbereichs Informatik der TU Berlin 1990/14.
LexiRom (1995): Multimediale Wissensbibliothek auf CD-ROM, hrsg. von Microsoft.
Nelson, T. (1987): Computer Lib. Dream Machines. Redmond: Tempus Books
of Microsoft Press.
Okopenko, A. (1970): Lexikon einer sentimentalen Reise zum Exporteurtreffen in Druden.
Roman. Salzburg: Residenz Verlag.
Schmitz, U. (1996): Kuntermund und Löwenmaul. Multimediale interaktive Lernsoftware
für Sprache und Linguistik (Prospekt). Essen:
Universität GH Essen, FB3.
Todesco, R. (1992): ”Software” - virtueller Partner oder Werkzeug.
Zürich: Neue Zürcher Zeitung 227, 30.9.92, 67.
Todesco Rolf (1995): Zeichen, Signal und Symbol. Überlegungen zur Begriffsverwendung
in Umgangssprache und in Mensch-Maschinen-
Kommunikation. In: Europäische Zeitschrift für
Semiotische Studien. 7(3-4), 685-692. Wien:
Institut for Socio-Semiotic Studies.
Todesco Rolf (1996): Die Definition als Textstruktur im Hyper-Sachbuch. In:
Knorr, D. / Jakobs, E (Hrsg.): Textproduktion
in elektronischen Umgebungen. [Textproduktion
und Medium; 2]. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang.